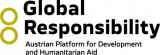Der Bedarf an humanitärer Hilfe nimmt zu. Der Krieg in der Ukraine, das Erdbeben in der Türkei und in Nordwest-Syrien, die eskalierende Gewalt in Burkina Faso – das sind nur ein paar aktuelle Beispiele, die Sie vielleicht in den Nachrichten gelesen haben. Es ist kein subjektives Gefühl, auch die Zahlen sprechen dafür: Immer mehr Menschen sind auf Unterstützung angewiesen. Aber was bedeutet das für die betroffenen Menschen selbst? Lassen Sie uns anlässlich der Eskalation des Krieges vor etwas mehr als einem Jahr in die Ukraine blicken.
Auf meinen Einsätzen mit Ärzte ohne Grenzen habe ich oft miterlebt, wie Menschen die Phasen einer Krise durchleben. Zuerst schalten sie in den Survivalmode, um das Überleben zu sichern. Danach kommen Gefühle hinzu wie Wut, Zorn, Trauer, woraus sich wieder neue Ressourcen mobilisieren lassen. Und irgendwann, wenn sich die Situation nicht so schnell zum Guten ändert, dann kommt die Phase der Akzeptanz, der brutale Moment, in dem die Betroffenen verstehen, dass sie mit und in der Krise leben müssen.
Lange war die Hoffnung bei vielen Menschen lebendig, dass der Krieg schneller vorbei ist. Er schwelt bereits seit 2014 – und auch seit der Eskalation letzten Februar ist schon ein Jahr vergangen. Millionen Menschen wurden vertrieben und leben unter prekärsten Bedingungen. Tausende – vor allem Alte und Kranke – sind nahe den Frontlinien zurückgeblieben. Es fehlt an Zugang zu Gesundheitsversorgung, viele Spitäler wurden zerstört.

Ärzte ohne Grenzen ist mit 810 Mitarbeiter:innen vor Ort im Einsatz. Wir unterstützen die Menschen mit mobilen Kliniken in Gegenden nahe den Frontlinien und in kürzlich von der Ukraine zurückeroberten Gebieten. Mittels Rettungswägen und einem medizinischen Zug helfen wir, Patient:innen in sicherere Gebiete zu bringen, damit sie versorgt werden. Wir bieten psychologische Unterstützung an, behandeln Kriegsverletze.
Meine Kolleg:innen, die mit den mobilen Kliniken im Einsatz sind, berichten vom massiven Bedarf an medizinischer Hilfe – aber auch von der großen Dankbarkeit der Menschen, dass sie nicht vergessen werden. Denn wie so oft in einer Krise besteht auch hier die Gefahr, dass immer weniger Scheinwerfer hingerichtet werden, das mediale Interesse nachlässt – und irgendwann auch die Hilfsmittel ausdünnen.
Wir als Ärzte ohne Grenzen waren bereits vor der Eskalation des Krieges in der Ukraine – und werden so lange bleiben, wie Bedarf besteht. Auf meinen Einsätzen sehe ich, wie stark die Betroffenen in Krisen sind. Sie haben meist selbst alles gegeben, aber irgendwann kommt der Punkt, wo das nicht mehr reicht.
Das, was wir leisten können, ist manchmal nur ein kleiner Beitrag zum großen Ganzen, der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein. Denn: Humanitäre Hilfe kann nicht die Welt retten – aber wir können ganz konkret einzelne Menschen retten. Und auch Sie können etwas tun. Schauen Sie hin, spenden Sie, engagieren Sie sich. Lassen wir uns gemeinsam nicht von der Ohnmacht überwältigen.
Marcus Bachmann ist Berater für humanitäre Angelegenheiten von Ärzte ohne Grenzen Österreich